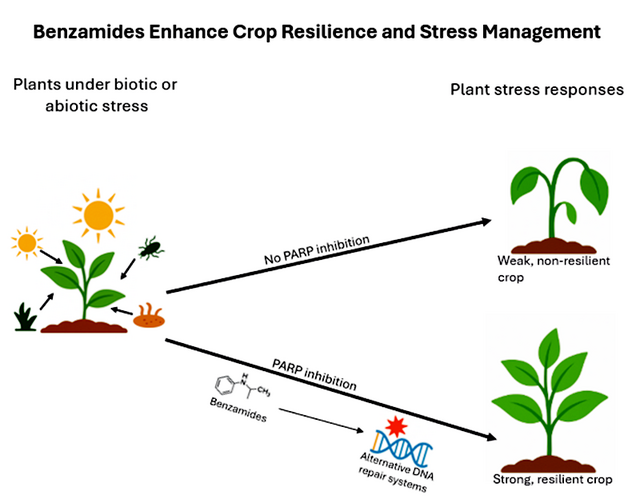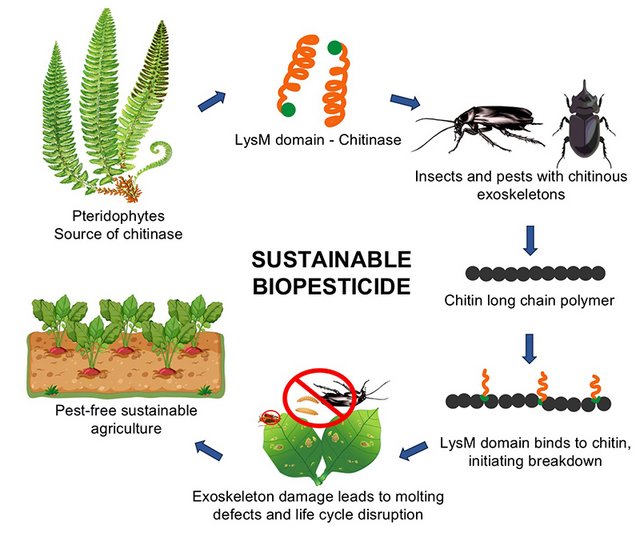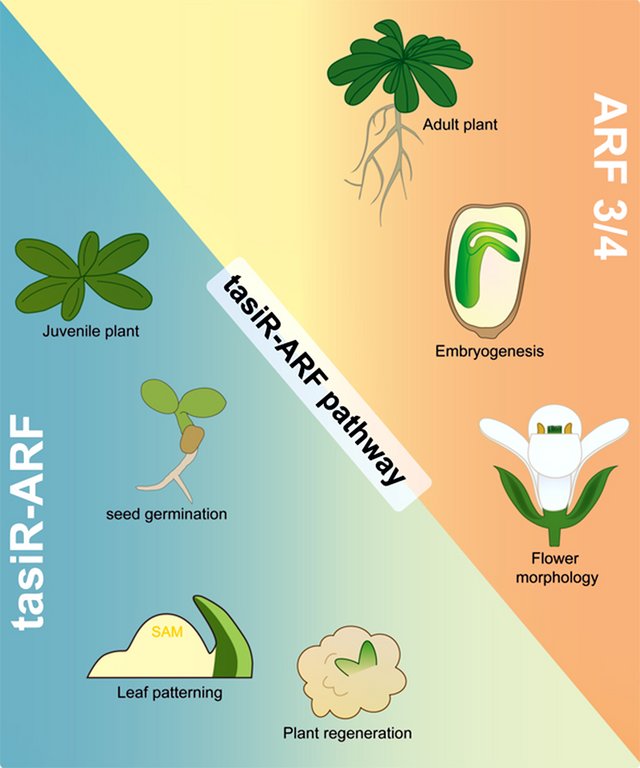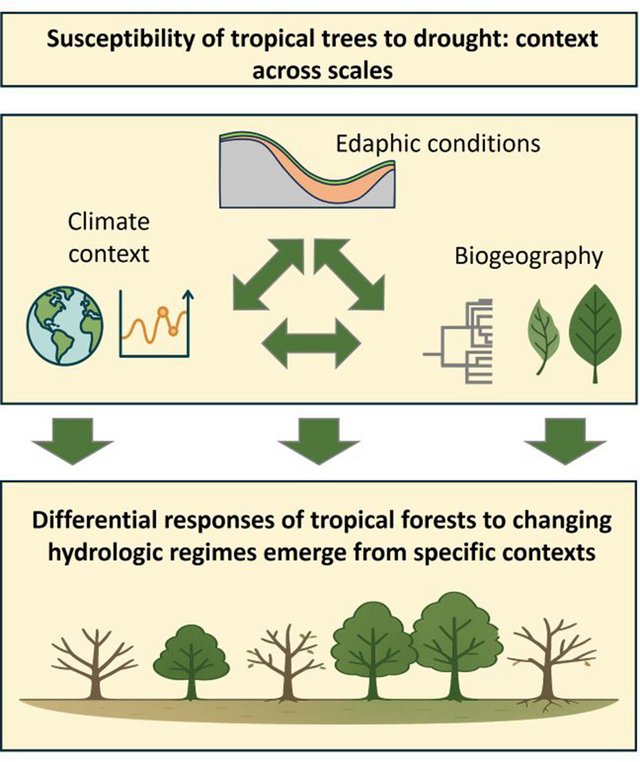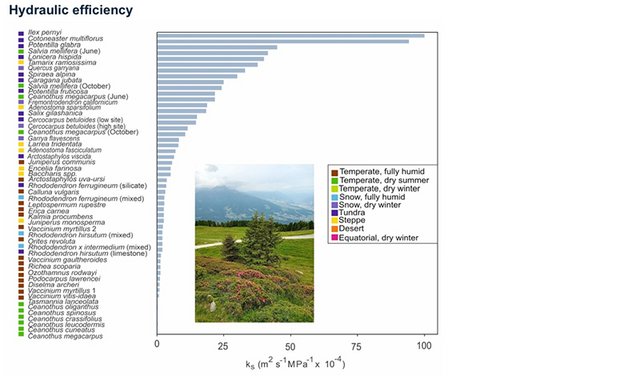Erste internationale Tagung über Stammzellen und Meristeme bei Getreidepflanzen
Das International Symposium on Cereal Meristems and Stem Cell Systems, welches von der DFG Forschungsgruppe FOR 5235 "Stammzellsysteme bei Getreide (CSCS): Etablierung, Aufrechterhaltung und Beendigung" organisiert wurde, brachte Ende September 2025 gut 90 Forschende aus 14 Ländern an der Universität Regensburg zusammen. Das Symposium war die erste internationale wissenschaftliche Konferenz, die ihren Fokus auf die Erforschung von pflanzlichen Stammzellen- und Meristemen insbesondere bei Getreiden wie Mais, Weizen und Gerste gerichtet hat. Die Organisierenden um Prof. Dr. Thomas Dresselhaus und Dr. Melanie Heinrich berichten über die Keynotes, die ausgezeichneten Arbeiten der Forschenden im frühen Karrierestadium (ECRs) und ihre Hoffnung, dass diese Tagung den Grundstein für weitere Konferenzen über diese aufstrebende Forschungsdisziplin legte.