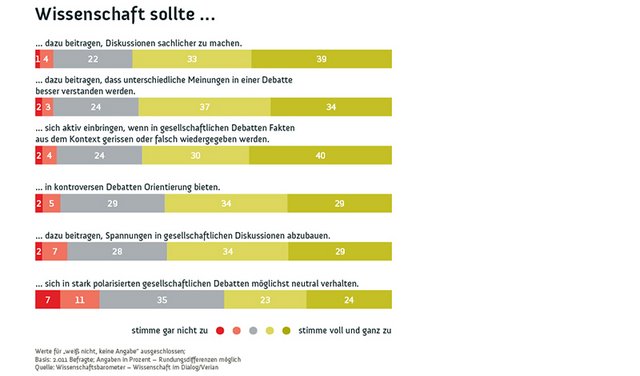Wie das Gen MKK3 die Keimruhe in Gerste steuert
Forschende haben herausgefunden, wie die komplexe genetische Kontrolle des Gens MKK3 die Keimruhe und das Keimrisiko von Gerste steuert. Dabei zeigte sich, dass einige Varianten eine größere Widerstandsfähigkeit gegenüber feuchten Erntebedingungen aufweisen. Die Zahlen aus der Forschung veranschaulichen die weltweite Verbreitung dieser Genvarianten und zeigen die Selektionsdynamik der jahrhundertelangen Domestizierung und Züchtung auf. Damit werden neue Wege zur Züchtung von Pflanzen aufgezeigt, die sowohl widerstandsfähig gegen extreme Wetterbedingungen als auch für vielfältige landwirtschaftliche Anforderungen geeignet sind. Die Ergebnisse des internationalen Teams unter der Leitung des Carlsberg-Forschungslabors und mit Beteiligung des Leibniz-Instituts für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung sind in einer Studie gestern im Fachmagazin Science veröffentlicht.