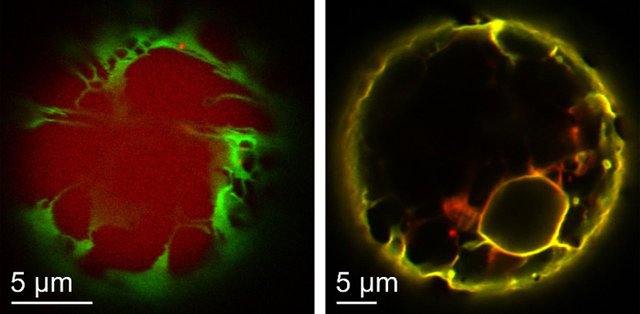Ökophysiologie des Wurzelraumes
Die 27. wissenschaftliche Arbeitstagung mit dem Titel „Ökophysiologie des Wurzelraumes“
wird vom 12. bis 13. September 2016 in der Lutherstadt Wittenberg (Sachsen –Anhalt) stattfinden. Themenschwerpunkte sind: Morphologie, Physiologie und Biochemie der Wurzeln, Pflanzen-Mikroben-Interaktionen, Rhizosphärenprozesse und ihre Beeinflussbarkeit, Zusammensetzung und Funktion wurzelbürtiger C- und N-Verbindungen; Stoffaufnahme, -umsetzung und -festlegung im Wurzelraum. Organisiert wird die Tagung von Prof. Dr. W. Merbach und Prof. Dr. Jürgen Augustin. Veranstalter sind das Institut für Agrar- und Ernährungswissenschaften der Martin-Luther- Universität Halle- Wittenberg in Verbindung mit der Fördergesellschaft für Agrarwissenschaften Halle e. V., der Deutschen Gesellschaft für Pflanzenernährung, der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft, Kommission IV, und das Institut für Landschaftsstoffdynamik im ZALF Müncheberg. Teilnahme- und Vortragsanmeldung bitte bis 25. August 2016 an den Organisator.
Details zur Tagung (pdf-Datei)
Anmeldeformular (als Word-Datei) / Anmeldeformular (als pdf-Datei)