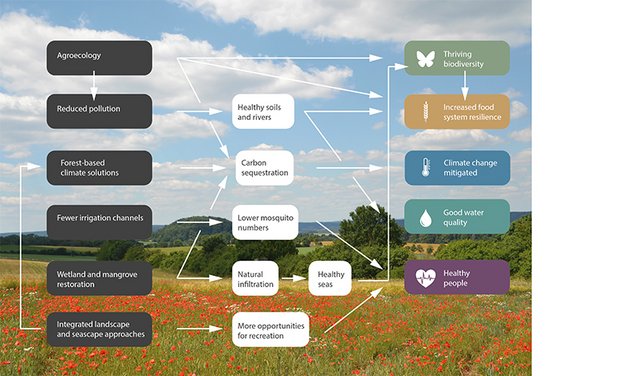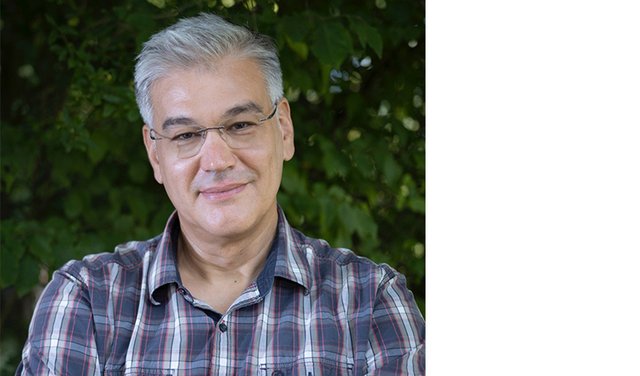Dynamik und Auswirkungen invasiver Arten
Eine internationale Studie zeigt erstmals, dass biologische Invasionen Ökosysteme nicht auf einheitliche Weise verändern. Einige Auswirkungen, insbesondere der durch invasive Arten verursachte Verlust einheimischer Pflanzenvielfalt, sind anhaltend und verstärken sich mit der Zeit. Andere Auswirkungen, wie etwa Änderungen des Nährstoffgehalts im Boden, klingen mit zunehmender Dauer der Invasionen oft ab, wie die Forschenden unter Leitung der Universität Bern berichten. Die im Fachmagazin
Science veröffentlichte Meta-Studie könnte bei der Entscheidung helfen, wann schnell gehandelt werden sollte und wann eine kontinuierliche Überwachung sinnvoller ist.