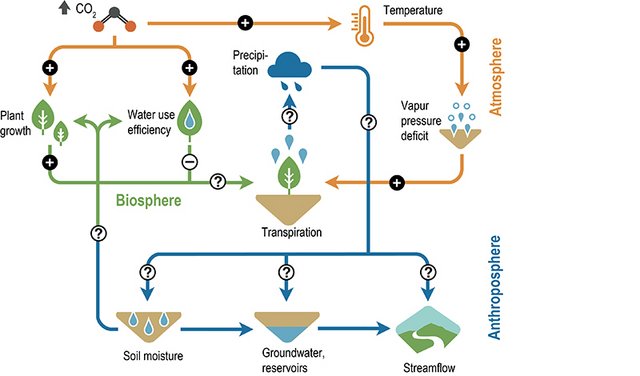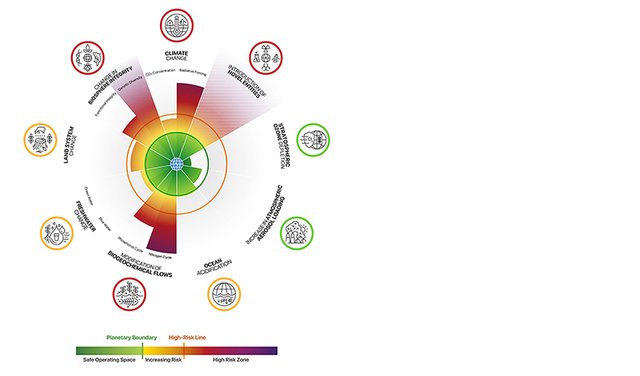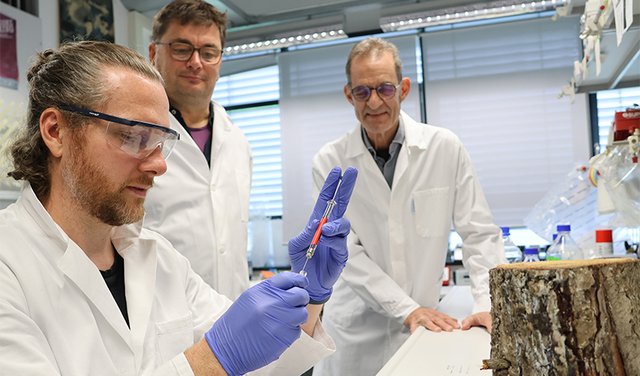Forschungsteam fordert mehr Fokus auf genetische Vielfalt im Biodiversitätsschutz
Die genetische Vielfalt – die Diversität innerhalb von Arten – ist eine entscheidende, jedoch oftmals unterschätzte Grundlage für den Schutz der biologischen Vielfalt. In einer aktuellen Publikation, die unter anderem von der Senckenberg-Forscherin Deborah M. Leigh geleitet wurde, wird die zentrale Rolle genetischer Diversität für eine „naturpositive“-Zukunft betont. Darunter versteht man einen Zustand, in dem Naturverluste nicht nur gestoppt, sondern auch rückgängig gemacht werden. Um dieses Ziel erreichen zu können, müsse die genetische Vielfalt bei der Erstellung von Management- und Schutzkonzepten berücksichtigt werden, so das internationale Forschungsteam. Als Beispiele nennen sie das Eschentriebsterben. Eine größere genetische Vielfalt erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass einige Bäume über die resistenzfördernde Gene verfügen. „Auch bei Seegräsern, die eine wichtige Rolle bei der Kohlenstoffspeicherung spielen und als Laich- und Aufzuchtgebiete für Fisch- und Muschelarten dienen, beobachten wir eine höhere Toleranz gegenüber Umweltveränderungen, wenn sie genetisch vielfältig sind," erklärt Letztautorin der Studie Prof. Dr. Deborah M. Leigh vom Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt und der Goethe-Universität Frankfurt. Ohne genetische Vielfalt fehle der Natur die Fähigkeit zur Anpassung – sei es an Krankheiten, den Klimawandel oder andere Umweltveränderungen, betonen die Autor*innen in der in People and Nature veröffentlichten Studie.