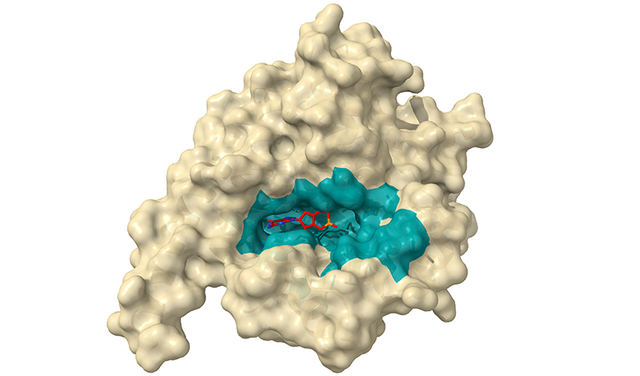Wie der Amazonas-Regenwald Trockenheit überstehen kann
Angesichts des Klimawandels und zunehmender Dürren steht der Amazonas-Regenwald unter immer größerem Druck. Eine neue Studie von Senckenberg-Forschenden zeigt, dass nicht nur die Größe oder Artenvielfalt des Waldes entscheidend für seine Widerstandsfähigkeit ist, sondern vor allem die hydraulische Vielfalt der Bäume. Wälder mit einer größeren Bandbreite hydraulischer Strategien – von tiefen Wurzeln über widerstandsfähige Leitbündel bis hin zu unterschiedlichen Wachstumsraten – überstehen Dürren deutlich besser. Dieses Ergebnis des Teams um Dr. Liam Langan vertieft nicht nur das Verständnis der Walddynamik, sondern hat auch weitreichende Auswirkungen auf Naturschutzstrategien und Klimamodelle. Veröffentlicht ist die Studie in Nature Communications.