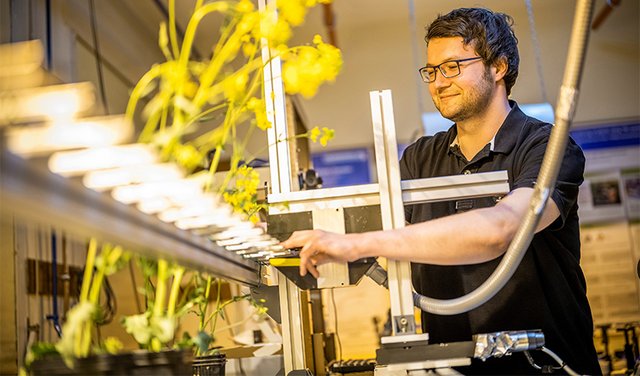Letzter Schritt der Biosynthese von Abwehr-Iridoiden aufgeklärt
Für die Biosynthese von Iridoiden, einer Klasse pflanzlicher Abwehrsubstanzen, die auch medizinisch relevant ist, blieb ein entscheidender Schritt bislang unentdeckt. Ein Team des Max-Planck-Instituts für chemische Ökologie in Jena konnte nun in Zusammenarbeit mit der University of Georgia und weiteren internationalen Partnerinnen und Partnern in der Brechwurzel nachweisen, welches Enzym für diesen Schritt verantwortlich ist. „Wir konnten zeigen, dass die von uns untersuchte Reaktion tatsächlich durch das Enzym katalysiert wird und die erwartete Substanz, das Nepetalactol, gebildet wird. Zu unserer Überraschung gehört das von uns gefundene Enzym jedoch zu einer vollkommen unerwarteten Klasse von Enzymen. Diese Enzymklasse ist bekannt dafür, eine völlig andere Reaktion zu katalysieren“, erläutert Maite Colinas, Gruppenleiterin in der Abteilung von Sarah O’Connor und Erstautorin der Studie. Das Enzym hat großes Potenzial, wichtige Iridoide und davon abgeleitete Krebsmittel zukünftig biotechnologisch herzustellen. Veröffentlicht at das Team die Ergebnisse in Nature Plants.