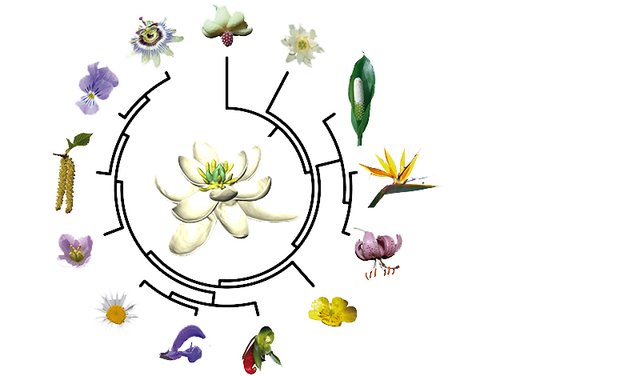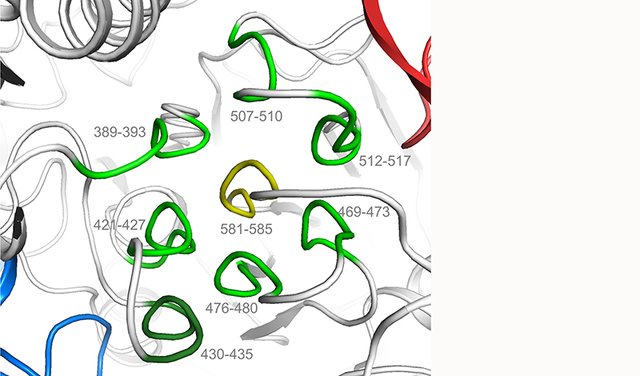Prähistorischer Mais betont Wert genetisch diverser Ressourcen
Zum ersten Mal ist es Forschenden gelungen ein komplexes Merkmal wie den Blütezeitpunkt von prähistorischem Mais zu bestimmen. Mais, der vor über 2000 Jahren angebaut wurde. Forschende der Cornell Universität und des Max-Planck-Instituts für Entwicklungsbiologie in Tübingen isolierten und analysierten Mais-DNA aus archäologischen Proben und verglichen sie mit der DNA moderner Mais-Sorten. Die nun in Science veröffentlichten Studienergebnisse zeigen, dass 2000 Jahre Selektion nötig waren, damit Mais auch in nördlichen Klimazonen wachsen konnte. So viel Zeit wird für die Anpassung moderner Mais-Sorten an den Klimawandel nicht zur Verfügung stehen.
Quelle: MPI für Entwicklungsbiologie